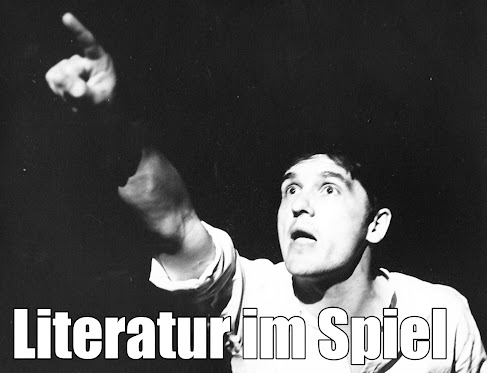Die Sonne ist schon südlich, der See glänzt, rings um den Ort leuchten grüne Matten. Direkt am Ufer, durch locker gepflanzte Bäume und Hecken gegen Sicht von der Straße geschützt, hat Major a. D. Albert von Giebler-Türkenfels sein Haus bauen lassen, eine Villa im italienischen Stil, mit schmiedeeisernen Verzierungen an Erkern und Balkonen unter weit vorspringendem Dach. In ländlicher Idylle erträgt der Veteran die Qualen seiner Verwundung aus den Balkankriegen. Jahrelang hat ihn seine erste Frau gepflegt, Ursula. Er hatte sich als Artillerieoffizier, sie sich als Krankenschwester auf Schlachtfeldern ausgezeichnet; der Kaiser persönlich hatte sie mit einem Orden geehrt, und die Leute im winzigen Rotau am See nannten sie schon bisweilen „Sankt Ursel“, denn sie betreute nicht nur den kranken Mann, sondern war mit Rat und Hilfe allen gegenüber freigiebig.
Albert war 44, als ihn am 19. August 1878 in der Schlacht von Sarajevo ein Schuss vom Pferd warf. Rippen brachen, sein eigener Degen durchbohrte den Kiefer. Im Lazarett wurde eine Rippe entfernt, Brüche mit silbernen Röhren ummantelt, damit sie halbwegs gerade zusammenwuchsen; die Wunde im Gaumen schloss sich nie mehr ganz, er konnte nur mit Mühe speziell für ihn Zubereitetes essen.
Elisabeth, Sophie und die Niednerin hatten auf der langen Reise per Bahn und Pferdekutsche von der Kommerzienrätin einiges über das Los des reichen Verwandten erfahren. Ursula war 1903 gestorben, die Ehe kinderlos geblieben. Die Familie hatte Alberts Vorschlag einer „Versorgungsehe“ mit der Nichte zweiten Grades zugestimmt. Elisabeth sollte den alten Herrn pflegen, ihn auf Reisen ins kroatische Ferienhaus oder an den Gardasee begleiten und den Haushalt führen, sie würde seine Erbin sein, das Vermögen – von dem ein beachtlicher Teil aus Ursulas Mitgift stammte – bliebe so in der Familie. Die Niednerin und ihre Tochter Sophie sollten zunächst für eine Probezeit als Hausangestellte dienen, hatten die Aussicht, dies in wechselseitigem Einvernehmen auch für längere Zeit zu tun…
Es verschlug den Frauen den Atem, kaum dass sie der Kutsche entstiegen waren. Haus und Garten am See inmitten der Berge erschienen ihnen paradiesisch; sie folgten dem Bediensteten, nachdem der gemeinsam mit dem Kutscher das Gepäck abgeladen und den leichteren Teil geschultert hatte. Vor der Haustür erwartete sie, auf einen Krückstock gestützt, Albert, der Invalide. Die Nachmittagssonne leuchtete in schütterem weißen Haar, er hielt sich gerade und lächelte ihnen zu…
Die Zeit jagte Elisabeth voran, sie lernte und arbeitete, kaum dass sie zur Besinnung kam, erstaunte alle mit Tempo und Geschick, ungeachtet ihres Handicaps. Die Hochzeit im Frühling des folgenden Jahres wurde zum Dorffest, der alte Mann und die einhändige jugendliche Frau waren hoch angesehen bei allen, die Umgang mit ihnen hatten. Auf St. Ursula folgte die Hl. Elisabeth. Sophie und die Niednerin hingegen blieben Fremde im Ort. Allerlei Gerüchte hefteten sich ihnen an – dass Sophie uneheliches Kind eines Adligen sei, beide wegen unehrenhaften Wandels aus Deutschland haben wegziehen müssen, die Niednerin insgeheim Hexenwerk triebe.